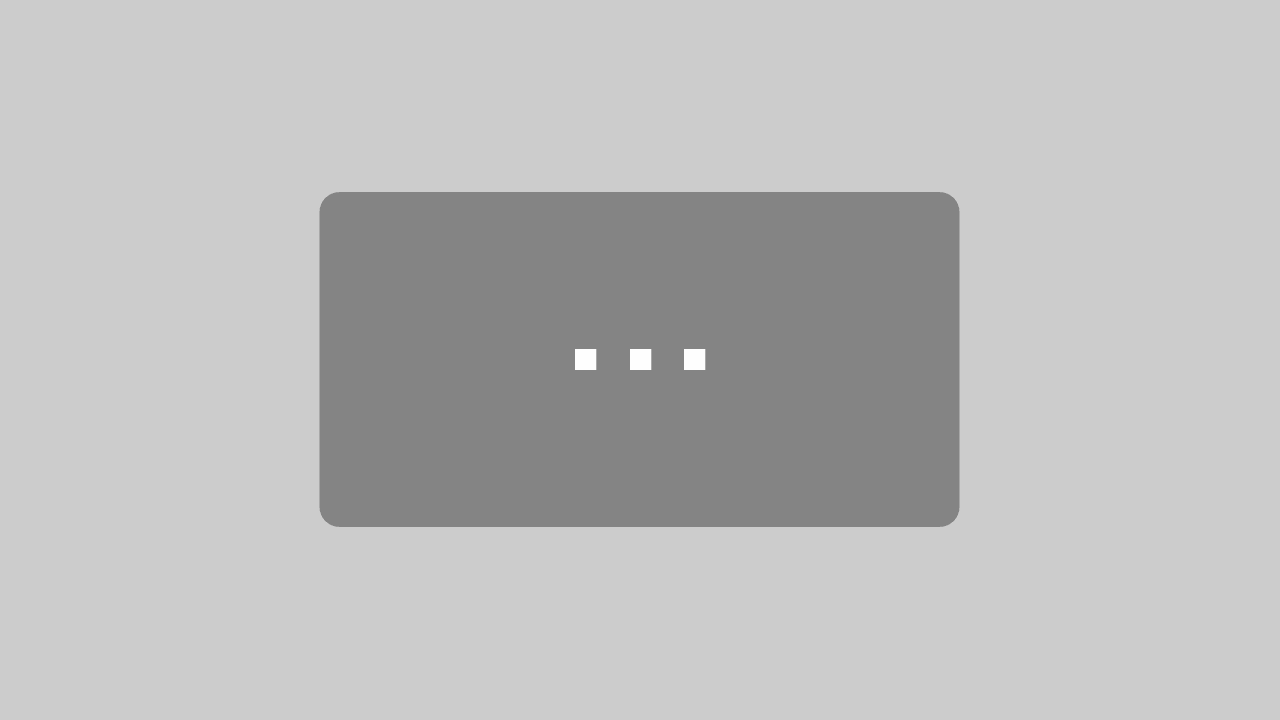This text is translated into English: Trauma from an EFT perspective.
Bessel van der Kolk schrieb zu Trauma: „Man braucht nicht als Soldat in einem Krieg gekämpft und kein Flüchtlingslager in Syrien oder im Kongo besucht zu haben, um Traumata zu kennen. Wir selbst erleben sie ebenso wie unsere Freunde, Familien und Nachbarn. Untersuchungen der Centers for Disease Control and Prevention zufolge wurde einer von fünf Amerikanern als Kind sexuell belästigt; einer von vier wurde von den eigenen Eltern so brutal geschlagen, dass am Körper dauerhafte Spuren zurückgeblieben sind; und in einer von drei Paarbeziehungen kommt es zu körperlicher Gewalt. Außerdem wächst ein Viertel aller amerikanischen Bürger bei alkoholkranken Verwandten auf, und einer von acht hat mit angesehen, wie die eigene Mutter zum Opfer häuslicher Gewalt wurde.“ (Bessel van der Kolk, 2015 S. 11)
Wie massiv die Folgen von Kindheitstrauma sind, hat die ACE-Studie (ACE = Adverse Childhood Experiences) gezeigt. Dies ist eine Studie, in der über 17.000 Erwachsene der US-amerikanischen Bevölkerung bezüglich Traumatisierungen in der Kindheit und deren Folgewirkungen untersucht wurden. Die Ergebnisse der ACE-Studie sind mehr als deutlich: Es besteht ein direkter Zusammenhang von Kindheitstraumata und der späteren Gesundheit im Erwachsenenalter – sowohl psychisch wie auch körperlich. Je mehr Traumatisierungen die Betroffenen in ihrer Kindheit erfahren haben, desto größer ist der negative Einfluss auf die Gesundheit. Z. B. bei drei Kindheitstraumata ist das Risiko auf Suizidversuche bereits um das Fünffache erhöht. Bei vier und mehr vorliegenden Traumata steigt das Risiko auf das Acht- bis Neunfache (siehe Bessel van der Kolk, 2015, Kapitel 11).
Es verwundert deswegen nicht, dass wir auch in der EFT Traumaüberlebende vor uns haben. Die Realität, in der ein Teil unserer Klienten lebt, hat Sue Johnson (2020, S. 215) treffend umschrieben: „ …und so überrascht es nicht, dass eine zentrale Realität in den Beziehungen zahlreicher erwachsener Traumaüberlebender darin besteht, dass es Partnern extrem schwerfällt, die Bindungssignale eines Überlebenden korrekt zu lesen und anteilnehmend darauf zu reagieren. Diese Signale sind zumeist verzerrt durch defensive Aggression oder Betäubung und kommen deshalb nicht an. Das Ausbleiben der erhofften Reaktion verstärkt nicht allein die Panik und Verzweiflung des Überlebenden, sondern auch die Entfremdung und Mutlosigkeit des anderen Partners. Überlebende sind auf die Unterstützung ihrer Partnerinnen und Partner angewiesen. Sie sind weniger gut in der Lage, auf erfolgversprechende Weise darum zu bitten. Menschen, die Kindesmissbrauch überlebt haben, neigen in hohem Maß dazu, einen desorganisierten Bindungsstil zu entwickeln (Shaver & Clarke 1994; Alexander 1993). Die emotionalen Wechsel von extremer Vulnerabilität und Bedürftigkeit zu extremen Vermeidungsverhalten und Kontaktabbrüchen, die für diesen Bindungsstil typisch sind, erleben Partner als verwirrend und lassen sie verzweifeln, sodass sie ihre Empathiefähigkeit einbüßen.“
Zur Diagnosestellung von Trauma
Traumata bekamen den Großteil des letzten Jahrhunderts wenig Aufmerksamkeit in der Psychotherapie. Durch die Einführung der PTBS in psychiatrische Klassifikationen wurden 1980 umfassende wissenschaftliche Studien zu dieser Diagnose möglich (van der Kolk, 2009). Sue Johnson schreibt in Emotionally Focused Couple Therapy with Trauma Survivors – Strengthening Attachment Bonds (The Guilford Press, 2002): „Für die formale Diagnose einer PTBS sind ein intrusives, drei Vermeidungs-/Betäubungssymptome und zwei Hyperarousal-Symptome notwendig. Allerdings werden viele der Probleme, die durch ein Trauma entstehen, in dieser Formulierung relativ unerkannt gelassen. Es ist auch selten, dass eine PTBS allein auftritt. Das Trauma selbst und die sekundären Schwierigkeiten, die bei der Bewältigung der Traumasymptome auftreten, machen das Auftreten zusätzlicher Probleme wie z.B. einer schweren Depression sehr wahrscheinlich. Feministische Konzeptualisierungen von Trauma kritisieren die Enge des Spektrums von Erfahrungen, die auf der Grundlage der DSM-Kriterien als traumatisch gelten. Sie weisen darauf hin, dass traumatische Ereignisse nicht „ungewöhnlich“ sind, wie es das DSM suggeriert. Im Leben vieler Frauen und Kinder sind sie eher alltägliche Ereignisse.“
Van der Kolk und andere Befürworter argumentieren bereits vor Jahren, dass die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) nicht alle Folgen einer schweren und komplexen Traumatisierung im Kindesalter abdeckt und schlagen eine Entwicklungstrauma-Störung vor (van der Kolk, 2009). Mit der Einführung der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung (K-PTBS) macht die ICD-11 einen wichtigen Schritt in diese Richtung. Laut ICD-11 entsteht die komplexe Form der PTBS durch länger anhaltende traumatische Ereignisse, bestehend aus mehreren oder sich wiederholenden Traumatisierungen. Es handelt sich dabei normalerweise um Ereignisse, aus denen ein Entkommen schwierig oder gar unmöglich ist (z. B. fortgesetzte häusliche Gewalt, wiederholter sexueller oder physischer Missbrauch in der Kindheit). Eine K-PTBS ist gekennzeichnet durch die PTBS-Kernsymptome (Wiedererleben, Vermeidung und Bedrohungsgefühl) sowie durch weitere Symptome, zusammengefasst als Störungen der Selbstorganisation. Diese werden definiert als:
- schwere tiefgreifende Probleme der Affektregulation,
- Probleme mit dem Selbstbild und selbst-herabsetzenden Überzeugungen,
- andauernde Schwierigkeiten in tragenden Beziehungen, im Gefühl der Nähe zu anderen, Schwierigkeit im Aufrechterhalten von Beziehungen.
Alle 3 Probleme der Selbstorganisation müssen für die Diagnose einer K-PTBS vorhanden sein. Sie können so stark vordergründig wirken, dass die 3 Kernsymptome der PTBS im Hintergrund schwer zu erkennen sind (Gysi, 2021). Als Beispiele beschreibt Jan Gysi (2021) Patienten, die Jähzorn und körperliche Gewalt des Vaters, emotionale Vernachlässigung und sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt haben oder die mit alkoholabhängigen und an unbehandelter chronischer Schizophrenie leidenden Eltern aufgewachsen sind.
Eine Idee des Ausmaßes von PTBS und K-PTBS unter Erwachsenen gibt eine Studie unter der erwachsenen Bevölkerung der Vereinigten Staaten (Cloitre et al, 2019). Insgesamt 7,2% der Stichprobe erfüllten die Kriterien für PTBS oder K-PTBS, und die Prävalenzraten betrugen 3,4% für PTBS und 3,8% für K-PTBS. Frauen erfüllten häufiger als Männer die Kriterien für PTBS und K-PTBS – Zahlen, die wir aus eigener Erfahrung in unserer Arbeit als EFT-Therapeuten bestätigt sehen.
Diese Studie zeigte auch, dass Bindungsbeziehungen eine wichtige Variable im Entstehen von K-PTBS sind. Sexueller und körperlicher Missbrauch in der Kindheit, der von einer Bezugsperson oder einem Betreuer begangen wurde, war im Vergleich zu anderen Traumata in einem multivariaten Kontext besonders stark mit dem Risiko für K-PTBS verbunden. Im Gegensatz dazu war sexueller Übergriff während der Kindheit, der nicht von Elternteilen oder Betreuern begangen wurde, mit PTBS verbunden.
Mit traumatisierten Klienten zu arbeiten, kann uns Therapeuten herausfordern. Die klinische Erfahrung hat gezeigt, dass sie tendenziell von einer trauma-informierten Therapie profitieren. Opfer von Missbrauch, Vernachlässigung und Misshandlung in der Kindheit entwickeln häufig eine breite Palette von altersabhängigen Psychopathologien mit verschiedenen psychischen Komorbiditäten.
Trauma & EFT
Die EFT basiert auf der Bindungstheorie und kombiniert systemische und experientielle Interventionen. Sie ist nicht-pathologisierend. Klienten, die in verengten Wahrnehmungs- und Reaktionsmustern gefangen sind, haben damit überlebt. Diese Muster sind entstanden in der Notwendigkeit, mit Bindungsunsicherheit oder -gefährdung umzugehen, um im unserem angeborenen Angewiesensein auf primäre Bindungsfiguren damals die meist mögliche Sicherheit, den größtmöglichen Schutz oder sogar das Überleben zu gewährleisten.
In der EFT rahmen wir Symptome ein in den inneren und relationalen Zyklus. Sie sind Ausdruck von in der Not entstandenen Emotionsregulationsstrategien und deren oft nachhaltigen Folgen. In der EFT sprechen wir mit unseren Klienten explizit über Trauma, wenn vorhanden, denn es stellt eine extra Herausforderung im Leben der Klienten dar. Trauma zu benennen, gibt Orientierung und damit ein Stück Sicherheit, es kreiert für unsere Klienten nicht selten Sinn und damit Verständnis für das eigene Erleben von dysregulierten emotionalen Zuständen – der „Deswegen-Effekt“ ist Teil des Deeskalationsprozesses in Phase 1 der EFT. Trauma-Drachen gehören in den Zyklus. Die EFT-Therapeutin fokussiert darauf, mit ihren Klienten Symptome als Folgen traumatischen Erlebens in der Bindungsperspektive neuzurahmen, und sie als temporäre Bindungsfigur dabei zu begleiten, korrigierende emotionale Erfahrungen in Beziehung zu sich selbst und zu relevanten Anderen zu machen.
Kontraindikationen und Voraussetzungen in EFT formulieren wir in Trainings folgendermaßen:
Kontraindikationen sind (Yolanda von Hockauf, Training-Handout, 2020):
- Psychosen: bedürfen medizinischer Interventionen
- Suizidalität: bedürfen stabilisierender Interventionen
- Akuter Substanzmissbrauch: bedürfen spezifischer Behandlung
- Antisoziale Persönlichkeitsstörungen etc.: Fähigkeit der Selbstreflektion und Inbesitznahme eigener Erfahrungen/Emotionen fehlt
Voraussetzungen sind:
- Klient muss in der Lage sein, sich im therapeutischen Prozess zu engagieren – zu einem gewissen Grad fokussieren können und sich in dem von uns gehaltenen Rahmen sicher genug fühlen.
- Klient muss den Fokus der Therapie auf Bindung und Emotionen für sinnvoll und hilfreich erachten (Aufgabenallianz).
- Klient bekommt Kontakt zu emotionalem Erleben, wenn auch nur partiell oder erst im Laufe des Prozesses, und kann / lernt es zu benennen.
- Wir als Therapeut/Therapeutin sehen uns selbst aufgrund unserer Qualifikationen und unseres Eigengefühls in der Lage, mit diesem Klienten zu arbeiten( therapeutische Selbstverantwortung).
Auch wenn keine Kontraindikationen vorliegen und die Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Arbeit mit Trauma im Alltag für uns EFT-Therapeuten in allen drei Modalitäten EFT, EFIT und EFFT keine Seltenheit.
Trauma Definition
Trauma ist überwältigendes, unkontrollierbares Erleben, das jedem in jedem Alter widerfahren kann. Die als lebensbedrohlich für sich selbst oder andere wahrgenommene Erfahrung löst Hilflosigkeit und intensive Angst aus, die das Toleranzfenster von Stress übersteigt. „Unsafe in our own skin“ („Unsicher in der eigenen Haut“) beschreibt Pat Ogden das Erleben von Trauma (Pat Ogden, 2015). Traumatisches Erleben kann durch das Erleben oder das Zeuge-sein von sexuellem, physischem, emotionalem Missbrauch oder Vernachlässigung in der Kindheit hervorgerufen werden, plötzlichen oder unerwarteten Verlust einer Bindungsperson, Kriegserfahrung, medizinische Behandlungen, Vollnarkosen, Naturkatastrophen u.a. Auch transgenerationale Weitergabe von Trauma findet zunehmend Beachtung.
Jedoch ist nicht das Ereignis selbst das Trauma, sondern wie ein Mensch darauf reagiert.
Trauma ist das Gekoppeltsein von Angst + Alleinsein + Immobilisation im autonomen Nervensystem
– so benennt es Peter Levine, der sich wie Sue Johnson auch auf die Forschungsergebnisse von Stephen Porges und seiner Polyvagaltheorie beruft. Im Zentrum des traumatischen Stresses liegt der Zusammenbruch der Fähigkeit, interne Zustände des Autonomen Nervensystems zu regulieren. Empfindungen, Emotionen, Kognitionen können nicht assoziiert werden. Sie werden dissoziiert, fragmentiert. Ohne bewusste Wahrnehmung untersucht unser ANS ständig die Umgebung, inwiefern es sicher für uns ist, und es legt Prioritäten bezüglich des adaptiven Verhaltens fest, die nicht kognitiver Natur sind. Trigger können Kampf, Flucht oder Erstarren auslösen – und bezogen auf die K-PTBS, sich zu unterwerfen – ‚fight, flight, freeze, fawn‘.
Trauma ist also eine Überwältigung des ANS. Es entscheidet für Schutz, respektive für Überleben. Können wir uns bei drohender Gefahr erfolgreich schützen, indem wir fliehen oder kämpfen, stellt sich im Organismus danach meist das natürliche Gleichgewicht wieder ein. Hier spielt eine entscheidende Rolle, ob jemand und wer an unserer Seite ist, und uns ggf. hilft, die überwältigende Erfahrung zu integrieren und zu koregulieren. Ein zusätzlicher entscheidender Faktor ist, ob die Gefahrenquelle „neutral“ oder ggf. unsere Bindungsfigur selbst ist.
In Berichten von Behandlungen der 9/11-Überlebenden im Rahmen ihrer Traumatherapie, dass die Ausprägung von Trauma entscheidend damit zu tun hatte, ob in Momenten nach der überwältigenden, lebensbedrohlichen Erfahrungen vertrauenswürdige Menschen emotional präsent waren oder nicht.
Kam Trauma in der Kindheit vor und das anhaltend oder in wichtigen, insbesonderen frühen Entwicklungsphasen, und bleibt Trauma unbehandelt, können die Zustände des ANS chronisch werden. Das System bleibt im Überlebensmodus „stecken“. War ein Abwehrverhalten erfolgreich, wird es als effektiv registriert, und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es in einer zukünftigen Bedrohungssituation genutzt werden wird. Betrifft das die Lebensphasen Pränatal, Geburt und ersten drei Lebensjahre, spricht man im Somatic Experiencing – nach Peter Levine – von „Global High Intensity Activitation“ (GHIA) des ANS. Das System lernt nicht, auf natürliche Weise zu regulieren. Trauma wirkt sich damit zu einer anhaltenden Unterbrechung von Verbundenheit aus. Das Überlebensreaktionssystem kann also chronisch aktiviert sein, was zu langfristigen Gefühlen von Alarm und Gefahr, zu der Tendenz, unter Stress zu fliehen oder zu kämpfen, oder zu lähmenden Gefühlen, extremer Verletzlichkeit und Erschöpfung, der Unfähigkeit, sich zu schützen, führt (Janina Fisher, www.janinafisher.com).
Die Forschung und klinische Literatur weisen eindeutig und übereinstimmend darauf hin, dass verschiedene Formen zwischenmenschlicher Traumata das Potenzial haben, sich auf den Kernaspekt der menschlichen Funktionsweise auszuwirken – auf Bindung (Sue Johnson, 2002). Traumaüberlebende, wenn getriggert, leiden unter unterschiedlichsten dysregulierten Zuständen des ANS. Damit beeinflusst Trauma auf vielen Ebenen. Das Selbstgefühl kann geprägt sein von Hilflosigkeit, Scham, Selbstbeschuldigen und Sich-nicht-Normal-fühlen. Bindungserleben und Emotionsregulation, Erinnerungs- und Wahrnehmungsfähigkeit, Erleben von Sinnhaftigkeit des Lebens und Mentalisierungsfähigkeit können beeinträchtigend sein. (s.a. Heather MacIntosh, 2019)
Sue Johnson und Leanne Campbell beschreiben im Rahmen ihrer EFT+Trauma-Trainings Trauma als Kontinuum und nennen die folgenden Faktoren:
- einmalig oder wiederholend
- im frühen Alter oder später
- interpersonell oder nicht-interpersonell
- waren Bindungspersonen die Gefahrenquelle oder nicht
- war Unterstützung durch Bindungspersonen vorhanden oder nicht vorhanden
- ist der Bindungsstil sicher oder unsicher
- wie viel Nähe bestand zum Ereignis
- besteht es transgenerational (hinzugefügt von Christine Weiß)
Koregulation
Koregulation ist die zentrale Aufgabe in primären Bindungsbeziehungen. Ohne die Erfahrung von Koregulation wird kein Vertrauen aufgebaut und kein emotionales Gleichgewicht gefunden. Die Wege des ANS, die Koregulation unterstützen, werden also nicht trainiert und nicht gestärkt. Somit entsteht unter Umständen ein einsamer Teufelskreis.
Deb Dana, die aus Stephen Porges Forschung einen psychotherapeutischen Ansatz entwickelt hat, benennt Koregulation als einen biologischen Imperativ – essentiell zum menschlichen Überleben. John Bowlby hat in seiner Bindungstheorie den Grundstein dafür gelegt. Selbstregulation bildet sich aufgrund fortlaufender Erfahrungen von Koregulation. Allein durch Koregulation kreiert sich der gefühlte Sinn – Felt Sense – von Sicherheit. Mit nicht integriertem Trauma steckt ein Mensch in Überlebensmustern fest, – laut Stephen Porges – im Shutdown des dorsalen Vagus und/oder in der sympathischen Erregung von Flucht und Kampf – oder er pendelt zwischen diesen zwei Zuständen und findet selten in den entspannten Zustand des ventralen Vagus, in dem wir emotionale Sicherheit und relationale Verbundenheit erleben können. Das ventrale Vagus-System zu aktivieren, ist das Ziel von Koregulation. Es ist das Ziel von sicherer Bindung und das Ziel von EFT.
Fazit
Die Wissenschaft sagt uns heute, dass eine sichere Bindung für jeden Aspekt der Gesundheit – mental, emotional und körperlich – entscheidend ist. Einsamkeit erhöht den Blutdruck bis zu einem Punkt, an dem sich das Risiko für einen Herzinfarkt und Schlaganfall verdoppelt. Die Forschung zeigt, dass Beziehungsstress das Risiko für Depressionen um das Zehnfache erhöht. Traumatisierung ist per Definition ein Risiko für Einsamkeit. Partner kämpfen mit dem Einfluss von Trauma. EFT arbeitet als konsequent bindungsbasierter Ansatz, in der Koregulation stattfindet und Klienten durch neue Erfahrungen der Emotionsregulation das Sicherheitserleben in Bezug auf wichtige Andere erweitern und mutiger in neue Erfahrungen gehen lernen, wo ihr negatives Arbeitsmodell von sich und anderen modifiziert wird. EFT kann Traumaüberlebende dabei unterstützen, als Persönlichkeiten zu wachsen und sich in der Welt sicherer zu fühlen.
Literatur
- Campbell, Leanne, Johnson, Sue (2020), EFIT + Trauma – Trainingsunterlagen.
- Cloitre et al. (2019), ICD-11 Posttraumatic Stress Disorder and Complex Posttraumatic Stress Disorder in the United States: A Population-Based Study, Journal of Traumatic Stress, 32, 833–842.
- Dana, Deb (2019), Die Polyvagal-Theorie in der Therapie: Den Rhythmus der Regulation nutzen.
- Gysi Jan (2021), Diagnostik von Traumafolgestörungen: Multiaxiales Trauma-Dissoziations-Modell nach ICD-11.
- Johnson, Sue (2002), EFT with Trauma Survivors. Strengthening Attachment Bonds.
Notiz: In 2021 ist eine Neuausgabe geplant, gefolgt durch eine deutsche Übersetzung bei Junfermann Verlag (2021 / 2022). - Johnson, Sue (2020), Bindungstheorie in der Praxis – Emotionsfokussierte Therapie mit Einzelnen, Paaren und Familien.
- Levine, Peter (2011), Sprache ohne Worte. Wie unser Körper Trauma verarbeitet und uns in die innere Balance zurückführt.
- Levine, Peter (1999), Trauma-Heilung. Das Erwachen des Tigers. Unsere Fähigkeit, traumatische Erfahrungen zu transformieren.
- Ogden, Pat, Fisher, Janina (2015), Sensorimotor Psychotherapy. Interventions for Trauma and Attachment.
- MacInstosh, Heather (2019), Developmental Couple Therapy for Complex Trauma.
- Die Handouts aus dem Buch „Developmental Couple Therapy for Complex Trauma: A Manual for Therapists“ von Heather B. MacIntosh sind eine wertvolle Ressource für Paare, die mit den Folgen von Trauma kämpfen.
- Perry, Bruce D, Oprah Winfrey (2022), Was ist dein Schmerz? Gespräche über Trauma, seelische Verletzungen und Heilung.
- Porges, Stephen (2010), Die Polyvagal-Theorie: Neuphysiologische Grundlagen der Therapie. Emotionen, Bindung, Kommunikation & ihre Entstehung.
- Rothschild, Babette (2002), Der Körper erinnert sich. Die Psychophysiologie des Traumas und der Traumabehandlung.
- Van der Kolk, Bessel (2009), Entwicklungstrauma-Störung: Auf dem Weg zu einer sinnvollen Diagnostik für chronisch traumatisierte Kinder, Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 58 (2009) 8, S. 572-586.
- Van der Kolk, Bessel (2019), Verkörperter Schrecken: Traumaspuren in Gehirn, Geist und Körper und wie man sie heilen kann.
DVDs
- Johnson, Sue (2012), Emotionally Focused Therapy in Action, Psychotherapy.net
- Johnson, Sue (2017), Facing the Dragon Together. EFT with Traumatized Couples, ICEEFT
- Johnson, Sue (2019), Emotionally Focused Individual Therapy (EFIT) Working with Anxiety and Depression, ICEEFT
- Johnson, Sue & Leanne Campbell (2020), EFIT – Nachhaltige Veränderung in der Emotionsfokussierten Einzeltherapie schaffen, ICEEFT
- Johnson, Sue & Leanne Campbell (2020), Escaping the Trauma Trap: Transforming Life-Long Trauma in EFT couple sessions, ICEEFT
Diese Seite teilen